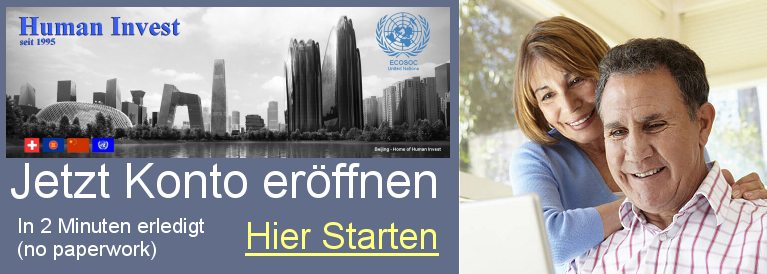Die Transatlantische Farce: Wie Europas „Deal“ mit Trump ein Pyrrhussieg am Rande des Zusammenbruchs ist, der niemals Ausicht auf Verwirklichung hat.
Human Investor Leser erhalten stets das gesamte Bild. Deshalb beträgt die Lesezeit dieses Artikels ca 20 Minuten.
Ein fragiler Waffenstillstand, kein Triumph
Die vielbeachtete „Grundsatzvereinbarung“ zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, die am 27. Juli 2025 verkündet wurde ist klar gescheitert.
Es war kein wegweisendes Handelsabkommen, sondern wäre eine kostspielige, vorübergehende Kapitulation Europas unter Zwang gewesen. Der Human Investor Blog berichtet bereits am 27.07 ausführlich in einer Analyse über die dort ausgehandelten Punkte.
Weit entfernt von einem Triumph, sieht sich diese vorläufige Einigung bereits einer überwältigenden Welle politischen und wirtschaftlichen Widerstands innerhalb der EU gegenüber. Einem so starken Druck, der eine vollständige Ratifizierung nahezu unwahrscheinlich macht. Sie stellt einen Pyrrhussieg für die EU dar, der einen Handelskrieg zu einem Preis abwendet, der europäische Industrien destabilisieren und ihre strategische Autonomie untergraben hätte.
Diese „Vereinbarung“ ist von Grund auf fehlerhaft, da ihr ein konkreter Rechtstext fehlt und sie auf Zugeständnissen beruht, die politisch unpopulär und wirtschaftlich schädlich für Europa sind. Der komplexe EU-Ratifizierungsprozess, insbesondere das Erfordernis der Einstimmigkeit bei „gemischten Abkommen“, in Verbindung mit dem heftigen Widerstand von Mitgliedstaaten und Wirtschaftsführern, bedeutet, dass diese Vereinbarung lange „in der Schwebe“ bleiben und letztendlich scheitern wird.
Die geopolitischen Auswirkungen, insbesondere im Hinblick auf eine mögliche Vergeltungsmaßnahme eines verbrecherischen US Präsidenzen wie Donald Trump, der dann lediglich „vorgeführt wurde“, könnten gravierend sein. Die EU täte wohl gut daran, sich schon jetzt verlässliche starke Partner im Osten zu suchen.
Die Illusion der Einigung: Was wurde „erreicht“?
Die „Grundsatzvereinbarung“: Eine Momentaufnahme der Zugeständnisse
Am 27. Juli 2025 verkündeten Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine „massive Handelsvereinbarung“. Das Kernelement dieser Einigung ist ein pauschaler Zoll von 15 Prozent auf die meisten EU-Waren, die in die USA exportiert werden, darunter Automobile, Computerchips und Pharmazeutika. Dies wurde als eine Reduzierung von Trumps zuvor angedrohten Zöllen von 30 oder sogar 50 Prozent dargestellt. Die Vereinbarung wurde nur wenige Tage vor Trumps Frist zum 1. August erzielt, um eine Eskalation der Zollmaßnahmen abzuwenden.
Die europäischen Verpflichtungen im Rahmen dieser Vereinbarung sind beträchtlich. Die EU hat sich zum Kauf von zusätzlichen 750 Milliarden US-Dollar an US-Energieexporten – Flüssigerdgas, Öl und Kernbrennstoffe – bis 2028 verpflichtet, mit dem Ziel, russische Lieferungen zu ersetzen. Darüber hinaus sagte die EU neue Investitionen in Höhe von 600 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten während Trumps Amtszeit zu. Präsident Trump behauptete zudem, die EU habe sich zum Kauf von Militärausrüstung im Wert von „Hunderten von Milliarden Dollar“ aus den USA bereit erklärt.
Das Zollregime zeigt eine ungleiche Landschaft. Würde ein 15-Prozent-Zoll breit angewendet werden, einige für die USA „strategische Sektoren“ wie Flugzeue, Halbleiterausrüstung, einige Agrarprodukte und kritische Rohstoffe jedoch von Zöllen ausgenommen werden, wäre dies zutiefst „unfair“. Und auch die bestehenden US-Strafzölle von 50 Prozent auf EU-Stahl- und Aluminiumimporte blieben unverändert. Dies wird jedoch langfristig nicht mehr hingenommen werden.
Ein entscheidender Aspekt dieser „Einigung“ ist das Fehlen konkreter Details. Beide Seiten räumten ein, dass „Details noch geklärt werden müssen“ und dass „noch nichts auf dem Papier steht“. Dies unterstreicht den vorläufigen Charakter der sogenannten „Grundsatzvereinbarung“.
Der Pyrrhussieg: Eine kostspielige „Abwendung“ des Handelskrieges
Die Vereinbarung wurde als Abwendung eines „ausgewachsenen Handelskriegs“ und einer „drastischen Zollerhöhung“ dargestellt. Doch der neue 15-Prozent-Zoll ist erheblich höher als der frühere durchschnittliche Zoll für europäische Waren in der „vor Trump Ära“, der nur 1,47 Prozent betrug.
Es wurde also von EU Seite ohne jeden echten Druck wirklich extrem schlecht verhandelt. Die angedrohten US Zölle sind dabei kein Argument. Diese wären bei Einführung von EU Gegenzöllen wohl sofort wieder „vom Tisch gewesen“. Während die Zölle für europäische Verbraucher völlig unwichtig sind, bedeuten sie für US Importeure eine erhebliche Kostensteigerung, Also keine Rückkehr zur früheren Normalität. Sie müssen ihre höheren Gestehungskosten nun an die US-Bürger weitergeben.
Die EU Hersteller und Exporteure befürchten hingegen einen Rückgang ihres Absatzes, weil ihre Waren dadurch in den USA erheblich teuerer werden. Wie dumm muss man als Verhandlungsführer sein, so ein „Abkommen“ auch nur in Erwägung zu ziehen?
Die wirtschaftliche Belastung ist beträchtlich und stellt keinen Vorteil dar. Bloomberg Economics schätzte, dass die neue Vereinbarung den effektiven US-Zollsatz auf europäische Waren auf 16 Prozent erhöht, was zwar eine Erleichterung gegenüber einem 30-Prozent-Szenario ohne Einigung darstellt, aber dennoch eine erhebliche Belastung bedeutet. Die EU hatte ihre BIP-Wachstumsprognose für 2025 aufgrund höherer Zölle bereits von 1,3 Prozent auf 0,9 Prozent gesenkt, und Capital Economics schätzt eine Reduzierung des EU-BIP um 0,5 Prozent durch weniger Warenabsatz in den USA eintritt.
Europäische Unternehmen müssen nun entscheiden, ob sie diese Kosten für ihre US Kunden absorbieren (übernehmen) sollen, zum Beispiel durch Preisnachlässe. Diese würden dann zwar ihre Gewinne schmälern, aber möglicherweise ihre Absatzzahlen und damit Marktanteile in den USA unberührt lassen.
Wobei dieses Szenario als nahezu ausgschlossen ersacheint, da die Margen sowieso schon, im Hinblick auf die chinesische Konkurrenz sehr dünn sind. Die erhöhten Zölle zahlen also nahezu ausschließlich die amerikanischen Bürger in Form höherer Preise.
Die Darstellung der Vereinbarung als „Neuausrichtung der Wirtschaftsbeziehungen“ und die Gewährung „beispielloser Marktzugänge“ für die USA, während die EU massive Energie- und Militärkäufe sowie Investitionen zusagt, offenbart eine stark einseitige Ausrichtung zugunsten der US-Wirtschaftsinteressen.
Trump betonte, die EU werde „15 % Zölle zahlen“ und „ihre Länder zollfrei für amerikanische Exporte öffnen“. Dies ist natürlich vom Grundgedanken her absoluter Unsinn. Die Europäer zahlen rein gar nichts, sondern die US Importeure, die EU Waren einführen. Das wird in den USA zu massiven Preissteigerungen dieser Güter führen.
Dies, zusammen mit den unveränderten 50-Prozent-Zöllen auf Stahl und Aluminium, deutet darauf hin, dass die Vereinbarung eine erzwungene Kapitulation der EU unter der Drohung von Strafzöllen ist, die darauf abzielt, Trumps wahrgenommenes Handelsdefizit zu beheben und die US-Industrien zu stärken. Es verdeutlicht die Hebelwirkung der USA und die defensive Haltung der EU. Dies würde nach Trumps Meinung angeblich auch die Europäer zu Infrastrukturprojekten in den USA anregen
Nun Infrastrukturprojekte führt nicht die EU aus, sondern ausschliesslich die in der EU beheimateten Unternehmen. Und diese entscheiden auch wo sie ihre benötigte billige Energie einkaufen. Und sollte dies durch Sanktionen oder Gesetzgebung verhindert werden, sind diese stark genug, den entspechenden Regionen den Rücken zu kehren. Es ist deshalb nun endgültig an der Zeit, den Handel mit der erpresserischen USA einzuschränken und neue Unternehmensteile keinesfalls dort anzusiedeln.
Sondern im Gegenteil, sich aus dem Einflussberich der USA, gegebenenfalls auch aus der EU, mit all ihren Gängelungen möglichst umfangreich zurückzuziehen. Dies bedeutet leider massiven Arbeitsplatzabbau, den man heute schon bereits deutlich sehen kann.
Ein Decoupling, und ein stärkerer Aufbruch in Richtung Osten ist angesagt. Dies auch im Hinblick auf den „Neuen Süden“ und den Märkten der immer stärker werdenden BRICS Staaten. Ihnen gehört die Zukunft.
Die Verpflichtung der EU, Energie im Wert von 750 Milliarden US-Dollar aus den USA zu kaufen, um „russische Lieferungen zu ersetzen“ , sowie erhebliche Militärausrüstungskäufe gehen über reine Handelsaspekte hinaus. Dies deutet auf eine strategische Verschiebung in der europäischen Energie- und Verteidigungsbeschaffung hin, die sich enger an den geopolitischen Zielen der USA orientiert.
Diese „Stabilität“ wird auf Kosten einer reduzierten europäischen Autonomie in kritischen strategischen Sektoren erkauft, was eine größere Abhängigkeit von den USA zur Folge hat. Nun, die europäischen Industrien sind noch relativ stark. Und sie werden wie oben bereits beschrieben ihre eigenen Wege gehen. Die Wirtschaft ist es nämlich, die eigentlich die Welt regiert, nicht dummePolitikern und Bürokraten. Dies haben sogar die Regierungen großer Volksrepublikenvklar erkannt.
Noch steht nichts auf dem Papier
Die wiederholten Feststellungen, dass „noch nichts auf dem Papier steht“ und „Details geklärt werden müssen“ , zeigt deutlich, dass es sich nicht um einen unterzeichneten Vertrag oder auch nur um eine vollständig ausgearbeitete Vereinbarung handelt. Es ist vielmehr nur eine hochrangige unverbindlich politische Absichtserklärung. Diese wurde lediglich angekündigt um die Zollfrist Trumps einzuhalten und einen vorübergehenden politischen Erfolg zu erzielen.
Den „Lumpen“ aus dem Weissen Haus dabei vor der Weltöffentlichkeit vorzuführen, wenn die Sache dann schlussendlich platzt, ist womöglich momentan gar nicht einkalkuliert, aber höchst wahrscheinlich. Das Fehlen eines konkreten, rechtsverbindlichen Textes bereitet das Scheitern bereits heute gründlich dafür vor. Dies macht diese „versuchte Erpressung“ nämlich gewollt außerordentlich anfällig für internen Widerstand innerhalb der EU.
Ein Chor der Empörung: Europas heftiger Widerstand
Politischer Flächenbrand: Politiker verurteilen „Unterwerfung“ und Schwäche
Die schärfste Verurteilung kam vom französischen Premierminister François Bayrou, der die Vereinbarung als „schwarzen Tag“ für Europa und als „Unterwerfung“ unter die USA bezeichnete. Er beklagte, dass „ein Bündnis freier Völker „sich der Unterwerfung hingibt“. Andere französische Beamte, darunter Europaminister Benjamin Haddad und Handelsminister Laurent Saint-Martin, äußerten ähnliche Bedenken, nannten die Situation „unbefriedigend“ und forderten Brüssel auf, sich nicht mit diesem Deal „zufriedenzugeben“, da dies bedeuten würde, dass Europa „keine Wirtschaftsmacht“ sei. Der Anführer der rechtsextremen Rassemblement National, Jordan Bardella, sprach von einer „kommerziellen Kapitulation“.
Der ungarische Premierminister Viktor Orban kritisierte die Verhandlungsstrategie der EU scharf und erklärte, US-Präsident Trump habe „Kommissionspräsidentin von der Leyen zum Frühstück verspeist“, womit er andeutete, sie sei im Vergleich zu Trump, den er als „Schwergewicht“ bezeichnete, ein „Leichtgewicht“. Orban hob auch hervor, dass die britische Regierung in ihren Verhandlungen mit den USA ein besseres Ergebnis erzielt habe, was die wahrgenommene Schwäche der EU-Position weiter unterstreicht.
So wird der Widerstand gegen diese unsägliche Kommissionspräsidentin auch täglich größer. Nur wenige Tage vor den Verhandlungen mit Trump hatte diese sich auch t einem Misstrauensantrag in der EU zu stellen. Ihren Posten in der EU erhielt diese, nach allgemeiner Meinun, auch Anfangs nur durch die Unterstüzung der früheren mächtigen Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nachdem „deren Mädchen“ als Bundesministerin in verschiedenen Ressorts jämmerlich versagt hatte, und sich anschickte auch die deutsche Bundeswehr komplett zugrunde zu richten, wurde diese dann nach Brüssel „weggelobt“. Vorher hatte sie jedoch noch Gelegemheit sich am Umbau des deutschen Schulschiffs Gorch Fock zu versuchen. Nun, nicht einmal dafür reichte ihr Können. Zudem stehen massive Korruptionsvorwürfe im Raum.
Auch im Europäischen Parlament äußerten wichtige Persönlichkeiten tiefe Besorgnis über deren, jedoch wohl erwartbares, schlechtes, Verhandlungsergebnis. Bezogen auf die Kompetenz dieser Frau, so wurde Human Investor unter der Hand bestätigt, sei dass alles „voraussehbar“ gewesen. Der CDU-Politiker Caspary bezeichnete die Einigung zwar sehr diplomatisch als „Weckruf“ für die EU, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, räumte jedoch ein, dass die 15-Prozent-Zölle „schmerzhaft“ seien. Die Grünen-Politikerin Cavazzini, Vorsitzende des Binnenmarktausschusses, nannte sie eine „sehr ungleiche“ Vereinbarung und erklärte, Trumps „Erpressungsstrategie“ habe funktioniert. Der Ko-Vorsitzende der Linksfraktion, Schirdewan, warf der EU-Kommission vor, sie sei vor US-Präsident Trump „eingeknickt“.
Die Reaktion von deutschen und französischen Politikern war von Vorsicht geprägt. Besonders EX Bundeskanzler Olaf Scholz, der nie für seinen Mut bekannt war, betonte, zwar, die EU sei „stark genug, um auf alles zu reagieren, was der europäischen Wirtschaft schadet“, hob aber auch die Notwendigkeit einer Einigung hervor, die „für alle Beteiligten besser ist“ und dass Europa „gemeinsam handeln und zusammenhalten“ werde. Aussagen ähnlicher Art häuften sich. Doch was will man konkret damit aussagen?
Der französische Präsident Emmanuel Macron betonte ebenfalls, dass „Trumps Aussagen Europa zu mehr Einheit drängen“ und dass „Europa respektiert werden und reagieren muss“. Bemerkenswerterweise reagierte Macron selbst äusserst feige also nicht unmittelbar auf die spezifische Vereinbarung, jedoch äußerten seine Parteifreunde erhebliche Kritik. Ihre öffentlichen Äußerungen konzentrierten sich auf eine breitere europäische Einheit und Wettbewerbsfähigkeit, anstatt die Bedingungen der Vereinbarung direkt zu befürworten.
Der deutsche Kanzler Friedrich Merz begrüßte in einem Akt vorauseilender Unterwerfung jedoch das Abkommen, da es „eine unnötige Eskalation der transatlantischen Handelsbeziehungen“ vermied, doch dies war ein vorsichtiger Empfang inmitten weit verbreiteter Kritik.
Wirtschaftlicher Gegenwind: Milliarden auf dem Spiel und gefährdete Prioritäten
Die exportorientierte deutsche Wirtschaft sieht sich einem „zweischneidigen Schwert“ gegenüber. Obwohl ein Handelskrieg abgewendet wurde, würden die 15-Prozent-Zölle auf Automobilprodukte, die von zuvor 2,5 Prozent gestiegen sind, die deutschen Automobilunternehmen „jährlich Milliarden kosten“ und sie „inmitten der Transformation“ zusätzlich belasten. Nach Einschätzung der Analysten des Human Investor Think Tanks wird diese Umwandlung jedoch sowieso nicht gelingen. Es spiele deshalb keine Rolle ob dies ein weiterer Sargnargel ist. Die Beerdigung findet, ob mit fest geschlossenem oder losem Sargdeckel, wohl auf jeden Fall statt.
Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), erklärte explizit das dies den Standort Deutschland weiter belaste und betonte die Notwendigkeit „funktionierender Lieferketten“ und „politischer Nachverhandlungen“. Volkswagen meldete bereits einen Gewinnverlust von 1,5 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2025 aufgrund höherer Zölle. Und dieser würde nun wohl weiter wachsen.
Auch die breitere Industrie verurteilte die Vereinbarung. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) kritisierte den Deal als „unzureichenden Kompromiss“, der die USA unverhältnismäßig stark begünstige. Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament, warnte, das Abkommen könne „interne europäische Prioritäten gefährden“.
Über die Automobilindustrie hinaus gibt es Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen des Deals auf Sektoren wie Pharmazeutika und Halbleiter, die nun möglicherweise einem 15-Prozent-Zoll unterliegen, trotz einiger anfänglicher Ausnahmen. Auch der Wein- und Biersektor ist von Unsicherheit betroffen, wobei Länder wie Frankreich und die Niederlande Ausnahmen fordern.
Allgemeine große Empörung über die Unterwerfung Europas
Während die unkompetente EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen die Vereinbarung als „Stabilität“ und „Planbarkeit“ bringend verteidigte , ist die überwältigende Reaktion führender Politiker und Wirtschaftsvertreter wichtiger Mitgliedstaaten (Frankreich, Ungarn, deutsche Industrie) eine der Empörung, Unterwerfung und erheblichen wirtschaftlichen Belastung. Dieser deutliche Kontrast offenbart eine erhebliche Diskrepanz oder eine wahrgenommene Überschreitung/Schwäche im Verhandlungsmandat oder der Ausführung der Kommission.
Das Mandat der Kommission besteht darin, im Namen der Mitgliedstaaten zu verhandeln, doch das Ergebnis scheint viele von ihnen entfremdet zu haben. Diese interne EU-Uneinigkeit macht jedoch den nachfolgenden Ratifizierungsprozess unmöglich , da die „Errungenschaft“ der Kommission von denjenigen, die sie letztendlich genehmigen müssen, weithin als Misserfolg angesehen wird. Dies untergräbt den internen Zusammenhalt der EU und ihre Fähigkeit, eine geeinte Front zu bilden.
Die Kritik des BDI, dass „interne europäische Prioritäten gefährdet“ seien , und die Bedenken hinsichtlich massiver Energie- und Militärkäufe aus den USA legen nahe, dass die Vereinbarung, anstatt die europäische Unabhängigkeit zu fördern, ihre Abhängigkeit von den USA vertiefen könnte. Der Kontext des „Ersatzes russischer Energielieferungen“ impliziert eine notwendige, aber kostspielige Verschiebung der Abhängigkeiten. Dies steht in direktem Konflikt mit dem erklärten Ziel der EU, eine größere strategische Autonomie zu erreichen. Die Vereinbarung wird von einigen als Rückschritt für Europas Bestreben angesehen, ein eigenständiger globaler Akteur zu sein, da sie Europa in kostspielige Abhängigkeiten von den USA in kritischen Sektoren zwingt und damit seine geopolitische Position schwächt.
Die vorsichtige öffentliche feige Haltung Deutschlands und Frankreichs, zweier wichtiger EU-Mächte, ist bemerkenswert. Während Bayrou und Orban lautstark kritisch sind, sind die Äußerungen von Merz und Macron entweder allgemeine Aufrufe zur Einheit und Wettbewerbsfähigkeit oder ein bemerkenswertes Fehlen einer sm Befürwortung derspezifischen Bedingungen des Deals. Die Beiden bleiben wie immer „schwafelnd“ im Nebel.
Dies deutet auf einen politischen Drahtseilakt hin. Sie können den Deal der Kommission, der einen Handelskrieg abwendete, nicht offen verurteilen, aber sie können auch keinen Deal vollständig befürworten, der im Inland so unpopulär und wirtschaftlich unglaublich schädlich ist.
Nun Merz wird sich mit irgendwelchen Aussagen retten, die sich dann wie immer als Lügen herausstellen. Ihr Fokus auf „Einheit“ und „Eskalationsvermeidung“ deutet darauf hin, dass sie die Folgen feige und schweigend bewältigen wollen , anstatt einen kommenden Sieg vorzuberiten.
Dies deutet darauf hin, dass selbst sie wohl tiefgreifenden Mängel des Deals erkennen und sich wahrscheinlich auf schwierige interne Debatten vorbereiten, anstatt seine Ratifizierung aktiv zu befürworten. Ihre relative Stille zu den Einzelheiten spricht Bände über die Unpopularität des Deals. Man kann jedoch heute schon sagen: In dieser Form wird es ihn nicht geben.
Der Ratifizierungs-Spießrutenlauf: Ein Hindernis für die Realität
Vom Prinzip zum Pakt: Der labyrinthartige EU-Prozess
Die Europäische Kommission erhielt das Mandat, im Namen der EU-Mitgliedstaaten zu verhandeln. Die Ankündigung vom 27. Juli 2025 stellt eine „Grundsatzvereinbarung“ oder eine „vorläufige Vereinbarung“ dar. Es muss jedoch klar sein, dass es sich dabei „noch lange nicht um ein Abkommen oder gar Vertragswerk handelt“. Im Prinzip ist es nahezu „Nichts“.
Der Ratifizierungsprozess für ein umfassendes Handelsabkommen in der EU ist bekanntermaßen komplex und mehrstufig. Zunächst muss die EU-Kommission das Abkommen den EU-Mitgliedstaaten und den EU-Gesetzgebern, insbesondere dem Europäischen Parlament, förmlich vorlegen. Anschließend muss der Rat der EU, der die Mitgliedstaaten vertritt, über die Genehmigung entscheiden. Während dies oft mit qualifizierter Mehrheit geschieht, ist bei bestimmten Fragen, wie etwa steuerrechtlichen Angelegenheiten, Einstimmigkeit erforderlich. Das Europäische Parlament muss seine Zustimmung erteilen oder verweigern; es kann keine Änderungen vornehmen.
Am Ende entscheiden die nationalen Parlamente der EU Staaten.
Die entscheidende Hürde ist die Ratifizierung durch die nationalen Parlamente. Wenn das Abkommen „geteilte Zuständigkeiten“ zwischen der EU und ihren Mitgliedstaaten betrifft, wird es als „gemischtes Abkommen“ eingestuft. In solchen Fällen ist die Ratifizierung durch die nationalen Parlamente aller EU-Mitgliedstaaten erforderlich. Hier wird dann für die Bürger der EU klar ersichtlich, welche Parteien und Politiker „Rückrat zeigen“. Für ein „gemischtes Abkommen“ muss die Entscheidung der Mitgliedstaaten „einstimmig“ sein. Dies bedeutet, dass ein einziges nationales oder sogar regionales Parlament, wie im Fall von CETA und Wallonien geschehen, das gesamte Abkommen blockieren kann.
Das Umfassende Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) mit Kanada dient als deutliche Warnung. Obwohl CETA seit 2017 vorläufig angewendet wird, bedarf es noch der vollständigen Ratifizierung durch alle nationalen und teilweise regionalen Parlamente. Stand November 2024 hatten noch nicht alle EU-Mitgliedstaaten CETA ratifiziert, was die Langwierigkeit und Herausforderung dieses Prozesses verdeutlicht. Die EU-Kommission hatte CETA ursprünglich als reine EU-Kompetenz eingestuft, revidierte diese Ansicht jedoch später und erkannte die Beteiligung der nationalen Parlamente an. So wird gerade darüber debattiert ob CETA eigentlich tod ist.
Das Damoklesschwert: Warum dieser Deal niemals Gesetz werden wird
Der Human Investor Think Tank stellt dazu fest: „Zu einer rechtsverbindlichen Handelsvereinbarung wird es nicht kommen. Die ganze Sache ist in „der Schwebe.“ und bleibt es auch. Diese Behauptung wird durch die vorliegenden Informationen umfassend gestützt. Der bereits geäußerte heftige Widerstand von politischen Führern (Bayrou, Orban) und mächtigen Wirtschaftsverbänden (VDA, BDI) aus wichtigen Mitgliedstaaten (Frankreich, Deutschland, Ungarn) macht die Aussicht auf Einstimmigkeit für ein „gemischtes Abkommen“ praktisch unmöglich.
Das Fehlen eines detaillierten, rechtsverbindlichen Dokuments lässt Raum für Spekulationen und verstärkt Bedenken, was es Gegnern leichter macht, Widerstand zu mobilisieren, ohne einen festen Text angreifen zu müssen. Die Tatsache, dass „Details in den ‚nächsten Wochen, Monaten oder Jahren geklärt werden müssen“, schafft einen offenen Prozess, der anfällig für politische Verschiebungen ist.
Die Möglichkeit einer „vorläufigen Anwendung“ ist unwahrscheinlich. Obwohl eine vorläufige Anwendung für Teile gemischter Abkommen, die ausschließlich in die Zuständigkeit der EU fallen, möglich ist , deutet die Prämisse („Dazu wird es nicht kommen“) darauf hin, dass selbst diese begrenzte Anwendung angesichts der Art der „Grundsatzvereinbarung“ und der Tiefe des Widerstands als absolut unwahrscheinlich angesehen wird. Der Umfang der vorläufigen Anwendung ist auf ausschließliche EU-Kompetenzen beschränkt , und eine Vereinbarung, die so massive Energie- und Militärverpflichtungen beinhaltet, berührt grundsätzlich immer gemischte Kompetenzen.
Das Erfordernis der Einstimmigkeit ist nicht nur ein verfahrenstechnischer Schritt, sondern ein politischer Vetopunkt. Angesichts des starken, lautstarken Widerstands aus Frankreich (Bayrou ) und Ungarn (Orban ) sowie erheblicher Bedenken der mächtigen deutschen Industrie (VDA, BDI ) ist es nahezu unmöglich, dass alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen werden.
Die Europäische Kommission hat diesen Deal im Rahmen eines Mandats der Mitgliedstaaten ausgehandelt. Die daraus resultierende Vereinbarung scheint jedoch das politisch Akzeptable für viele dieser Mitgliedstaaten überschritten zu haben. Dies führt zu einer Legitimitätskrise für die Handelspolitik der Kommission, bei der ihre Verhandlungsmacht durch die nachfolgenden Ratifizierungsanforderungen untergraben wird.
Diese Situation offenbart eine grundlegende Spannung in der EU-Handelspolitik: die Exekutivgewalt der Kommission zum Verhandeln versus das letztendliche souveräne Recht der Mitgliedstaaten zur Ratifizierung. Die Unpopularität des aktuellen Deals zeigt, wie diese Spannung zu Lähmung und Scheitern führen kann, selbst nachdem eine „Grundsatzvereinbarung“ erzielt wurde.
Trumps Vergeltung: Die unvermeidlichen Folgen des Scheiterns
Die Kunst des Deals, entwirrt: Eine Rückkehr zur „America First“-Aggression
Donald Trump hat stets einen protektionistischen „America First“-Wirtschaftskurs verfolgt, der durch den aggressiven Einsatz von Zöllen zur Reduzierung von Handelsdefiziten gekennzeichnet ist. Er betrachtet Handel als ein Nullsummenspiel und hat in der Vergangenheit wiederholt mit hohen Zöllen gedroht und diese umgesetzt, um Zugeständnisse zu erzwingen. Sein Konzept der „wechselseitigen Zölle“ impliziert, dass die USA, wenn andere Zölle erheben, mit eigenen, oft höheren Sätzen reagieren werden.
Trumps Verhandlungsstil ist stark personalisiert. Er lobte die „massive Handelsvereinbarung“ öffentlich und präsentierte sie als großen Gewinn für die USA. Ein Scheitern der Ratifizierung, insbesondere nach einer so öffentlichen Ankündigung, würde von ihm wahrscheinlich als direkte Beleidigung und persönlicher Verrat durch die EU und ihre Führung (insbesondere von der Leyen, die Orban bereits als von Trump „zum Frühstück verspeist“ darstellte ) wahrgenommen werden.
Ein Scheitern der „Grundsatzvereinbarung“ würde fast sicher eine schwere Reaktion von Trump auslösen. Dies würde wahrscheinlich die Wiedereinführung der zuvor angedrohten 30- oder sogar 100-Prozent-Zölle auf eine breite Palette von EU-Waren, einschließlich Automobile, die er zuvor ins Visier genommen hatte, umfassen. Er hat auch die Bereitschaft gezeigt, 200-Prozent-Zölle auf Medikamente zu erheben. Der „vorübergehende Aufschub“ würde enden und zu einem ausgewachsenen transatlantischen Handelskrieg führen, wobei die EU wahrscheinlich mit eigenen „Gegenzöllen“ reagieren würde.
Kommt es doch noch zum großen Handelskrieg?
Es ist bei einem Scheitern mit harscher öffentlicher Verurteilung der EU durch die USA zu rechnen, die ihr schlechten Glauben, unfaire Praktiken und die Untergrabung der US-Wirtschaftsinteressen vorwerfen würde.
Hierzu kann man sagen: Der amerikanische Dummkopf wusste nicht, das zwar die EU Politiker schwach sind, aber die Komplexität des EU Aufbaus und der EU Bürokratie, auch ein für ihn unüberwindbares Hindernis darstellen. Schnell, wie er es sich vorstellt, geht da gar nichts. Alles Vereinbarte wird in den langsam arbeiteten Mühlen der nächsten Monate , im Ratifizierungsprozess, genüsslich zerrieben werden.
Trumps Ansatz in den internationalen Beziehungen ist stark transaktional, wobei er wahrgenommene unmittelbare wirtschaftliche Gewinne für die USA über traditionelle Allianzen oder langfristige diplomatische Stabilität stellt. Die „Vereinbarung“ selbst war das Ergebnis von Zolldrohungen, nicht von kollaborativen Verhandlungen. Wenn die EU die „Vereinbarung“ nicht einhält, wird Trump dies daher als Bruch einer kommerziellen Transaktion und nicht als diplomatischen Rückschlag betrachten und mit strafenden wirtschaftlichen Maßnahmen reagieren. Das Scheitern der EU bei der Ratifizierung wird von Trump als direkte Herausforderung seiner „Kunst des Deals“ interpretiert und eine Reaktion auslösen, die auf wirtschaftlichem Zwang basiert, anstatt auf diplomatischem Engagement, was die transatlantischen Beziehungen weiter schwer beschädigen wird.
Eine neue transatlantische Kluft? Geopolitische Implikationen eines gescheiterten Deals
Ein Handelskrieg würde die transatlantische Allianz, die bereits durch frühere Trump-Administrationen auf die Probe gestellt wurde, schwer belasten. Er könnte die Zusammenarbeit in kritischen Sicherheitsfragen, einschließlich der NATO, und bei globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel untergraben. Die Hauptmotivation der EU für den Deal war es, die diplomatischen Beziehungen und die US-Unterstützung für die Ukraine zu erhalten. Doch wie wichtig ist überhaupt noch die Ukraine?
Das „Abkommen“ sollte die Wirtschaftsbeziehungen „neu ausbalancieren“. Sein Scheitern wird wohl zu einer weiteren wirtschaftlichen Entkopplung führen, die beide Seiten zwingt, alternative Handelspartner und Lieferketten zu suchen, was mit erheblichen Kosten und Störungen verbunden wäre. Der Zusammenbruch eines so hochkarätigen Abkommens zwischen so großen Volkswirtschaften würde eine beunruhigende Botschaft über die Durchführbarkeit multilateraler Handelsverhandlungen aussenden und die bereits unter Druck stehende regelbasierte globale Handelsordnung weiter schwächen.
Trumps frühere Handlungen und die Natur dieser „Grundsatzvereinbarung“ (z. B. massive Energie- und Militärkäufe ) zeigen seine Bereitschaft, Handelspolitik als direktes Instrument geopolitischer Hebelwirkung einzusetzen. Ein gescheiterter Deal wäre nicht nur ein Handelsstreit; es wäre eine geopolitische Konfrontation, die möglicherweise den NATO-Zusammenhalt und die geeinte Front des Westens gegen Widersacher, die es vielleich so gar nicht gibt.
Der Zusammenbruch des Deals verwandelt eine kommerzielle Meinungsverschiedenheit in eine ausgewachsene geopolitische Krise, die die transatlantische Allianz möglicherweise spaltet und Europa zwingt, seine strategischen Schwachstellen selbst auszugleichen.
Die anfängliche Markterleichterung bei der Ankündigung des Deals, gefolgt von Verlusten, als Details bekannt wurden, deutet auf einen „Dead Cat Bounce“ hin – eine vorübergehende, irreführende Erholung nach einem starken Rückgang.
Die „Grundsatzvereinbarung“ verzögerte lediglich den unvermeidlichen Handelskonflikt und vermittelte eine kurze Illusion von Stabilität. Wenn sie scheitert, wird die Marktreaktion wahrscheinlich weitaus schwerwiegender sein als die anfängliche Erleichterung. Die aktuelle „Vereinbarung“ ist somit eine vorübergehende Konfliktverschiebung, keine Lösung. Ihr Zusammenbruch wird zu einem intensiveren und schädlicheren Handelskrieg führen, wobei die Märkte negativ auf die erneute Unsicherheit und höhere Zölle reagieren werden.
Europas Scheideweg – Souveränität oder Unterwerfung?
Die vielgepriesene „Grundsatzvereinbarung“ zwischen der EU und den USA ist kein Triumph der transatlantischen Zusammenarbeit, sondern ein fragiles, kostspieliges Zugeständnis Europas, gegenüber einem früherem Imperium, das bereits am Rande des Zusammenbruchs steht. Sie stellt einen vorübergehenden Aufschub eines Handelskriegs dar, erkauft zum Preis erheblicher wirtschaftlicher Belastungen und einer wahrgenommenen Unterwerfung unter amerikanische Forderungen. Das Fehlen eines konkreten Rechtstextes und der überwältigende interne Widerstand innerhalb der EU offenbaren ihre inhärente Instabilität.
Der komplexe, vielschichtige EU-Ratifizierungsprozess, insbesondere das Erfordernis der Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten für „gemischte Abkommen“, in Verbindung mit dem heftigen politischen und wirtschaftlichen Widerstand aus wichtigen europäischen Hauptstädten und Industrien, macht die vollständige Umsetzung dieses „Deals“ nahezu unwahrscheinlich. Er befindet sich tatsächlich „in der Schwebe“ und wird voraussichtlich nicht „zustande kommen.“
Sollte diese „Grundsatzvereinbarung“ scheitern – ein höchst wahrscheinliches Szenario –, werden die Folgen, insbesondere unter einem potenziell verbrecherischen Donald Trump, gravierend sein. Es ist eine schnelle und aggressive Rückkehr zum „America First“-Protektionismus zu erwarten, gekennzeichnet durch erneute Drohungen mit Strafzöllen, öffentliche Verurteilungen und einen ausgewachsenen transatlantischen Handelskrieg. Dies würde nicht nur weiteren wirtschaftlichen Schaden anrichten, sondern auch die geopolitische Allianz tiefgreifend belasten und die Zusammenarbeit in globalen Sicherheits- und strategischen Fragen beeinträchtigen.
Europa steht an einem kritischen Scheideweg. Der aktuelle „Deal“ zwingt zu einer klaren Wahl zwischen einer wahrgenommenen Unterwerfung unter externen Druck für vorübergehende Erleichterung oder einer entschlossenen Behauptung seiner wirtschaftlichen Souveränität und strategischen Autonomie, selbst wenn dies einen Handelskonflikt bedeutet.
Der Weg nach vorn erfordert eine geeinte und entschlossene europäische Haltung. Die aktuelle Farce unterstreicht die dringende Notwendigkeit für Europa, seinen eigenen Weg in einer multipolaren Welt zu gehen, anstatt ständig auf die Vorgaben anderer zu reagieren. Doch man darf nicht vergessen, auch wenn es für viele fiktional klingt. Im Osten wartet der „große Freundesverbund “ für die Europäer, der heute schon den Großteil der Weltbevölkerung repräsentiert, und der bisher, im Gegensatz zu den unlauteren USA noch nie entäuscht hat.